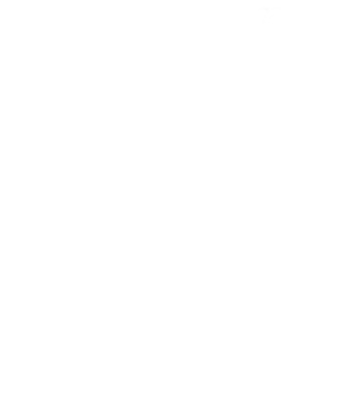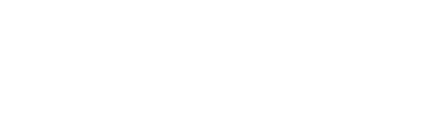Zunächst unterstrich Innenstaatssekretär Christian Hochgrebe die klare Position des Berliner Senats im Kampf gegen Rechtsextremismus. Der Feindseligkeit gegenüber einer demokratischen und offenen Gesellschaft und gegen Menschen mit Migrationsgeschichte müsse entschlossen entgegengetreten werden. Weiterhin führte der Staatssekretär aus, dass der wehrhaften Demokratie das Instrument des Parteienverbots gem. Art. 21 Absatz 2 GG zur Verfügung steht, sofern die Kriterien der Verfassungsfeindlichkeit erfüllt seien. Einen wichtigen aktuellen Beitrag zur begrifflichen Klärung dieser Kriterien habe das Oberverwaltungsgericht Münster in seinem Urteil zur Verdachtsberichterstattung erbracht. Das weitere Vorgehen hinsichtlich eines möglichen Verbotsverfahrens sei indes Gegenstand des bewährten Vorgehens im Verbund von Bund und Ländern, den Regierungen sowie dem Bundesamt für Verfassungsschutz und den Landesämtern. Zudem sei die Prüfung und Bewertung von Hinweisen auf Verfassungswidrigkeit ohnehin Aufgabe der Verfassungsschutzbehörden. Somit bedürfe es insgesamt auch des vorliegenden Antrages nicht, wie es auch bereits im Berliner Ausschuss für Innere Sicherheit und Ordnung festgestellt wurde.
Als erster Anzuhörender warf Prof. Dr. Philipp Austermann von der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung aus dem Fachbereich Staats- und Europarecht einige Fragen zum vorliegenden Antrag auf. Insgesamt sei im Antragstext unklar, wer genau das Material zur Verfassungsfeindlichkeit sammeln solle und insbesondere mit welchen Methoden die Informationen erhoben würden. So unterlägen etwa die Verfassungsschutzämter besonderen grundgesetzlichen Bindungen, insbesondere in Hinblick auf Persönlichkeitsrechte. Bei der Beobachtung gehe es um die Grundrechte anderer und die Inhalte von Materialsammlungen müssten auch hinsichtlich ihres Zustandekommens gerichtsfest sein. Prof. Austermann stellte fest, dass der Verfassungsschutz ein bewährtes Mittel sei, mit diesen hohen Ansprüchen umzugehen. Wie auch Staatssekretär Hochgrebe sehe er demnach bei der Datensammlung durch „Private“ Zurückhaltung geboten. Ebenfalls sei davon auszugehen, dass Veröffentlichungen aus der Wissenschaft und von zivilgesellschaftlichen Organisationen ohnehin bereits jetzt Eingang in die Betrachtungen der Verfassungsschutzämter finde. Mithin ergebe es sich aus deren Auftrag, entsprechenden Hinweisen nachzugehen. Somit sei insgesamt nicht klar, was letztlich der Mehrwert des vorliegenden Antrags sei.
Weitere Diskussionsbeiträge lieferten die Sachverständigen Prof. Dr. Felix Hanschmann von der Bucerius Law School, Inhaber des Dieter-Pawlik-Stiftungslehrstuhls für Kritik des Rechts sowie Dr. Bijan Moini, Legal Director und Syndikus von der Gesellschaft für Freiheitsrechte e.V. sowie die Kollegen aus der SPD sowie der Opposition. Insgesamt wurde trotz eines grundsätzlichen gemeinsamen Bekenntnisses zum Instrumentenkasten der wehrhaften Demokratie deutlich, dass man sich bei der Anwendung von Erhebungsmethoden mit dem Ziel eines Parteiverbots doch uneinig ist.
Mein grundsätzliches Störgefühl hinsichtlich einer zu ausgeprägten Rolle von Nichtregierungsorganisationen brachte ich mit dem Hinweis auf den Punkt, dass nicht-staatliche Organisationen in diesem Zusammenhang nicht Dinge unternehmen sollten, die staatlichen Behörden nicht gestattet sind. Bei der Beobachtung innerhalb der Mitglieder der Zivilgesellschaft untereinander ist Zurückhaltung geboten. Ich bin der Meinung, dass es der freiheitlichen Gesellschaft und dem breiten Diskurs schadet, wenn nicht-staatliche Organisationen strukturierte Beobachtungen durchführen. Beobachtung per se ist immer rechtfertigungsbedürftig und aus guten Gründen an enge Voraussetzungen gebunden, wenn sie von staatlicher Seite initiiert und durchgeführt wird. Es ist natürlich im Rahmen von Presse- und Wissenschaftsfreiheit unstrittig möglich, offene Informationen zu sichten und zu verwerten. Allerdings sehe ich klar eine Grenze überschritten, wenn jemand unerkannt an öffentlichen Veranstaltungen einer Organisation teilnimmt mit dem Interesse, die Organisation vom Markt zu nehmen. Das halte ich für problematisch. Verdeckte Beobachtung sollte auch weiterhin nur in engem Rahmen durch staatliche Behörden durchgeführt werden. Eine im behandelten Antrag beabsichtigte Einbeziehung von eigenständig erhobenen Materialsammlungen von Wissenschaft und Zivilgesellschaft, die auch verdeckt gewonnene Erkenntnisse miteinbeziehen, wäre ein schädlicher Schritt hin zu einer Beauftragung von Nichtregierungsorganisationen mit äußerst sensiblen Aufgaben, die zum staatlichen Kernaufgabenbestand gehören. Selbst dann, wenn dies in Grenzen rechtlich möglich sein sollte, ist ein solches privates ‚Bespitzeln‘ in keinem Fall dem Zusammenleben in einer offenen Gesellschaft zuträglich. Fangen Mitglieder einer Gesellschaft an, sich systematisch gegenseitig zu beobachten und anzuzeigen, um missliebiges Fehlverhalten unterhalb der Strafbarkeitsgrenze zu entdecken und zu bekämpfen, so säht dies Angst und Misstrauen.
Wie häufig in unseren Debatten im Verfassungsschutzausschuss wurde hier deutlich, dass Kriterienklarheit essenziell ist beim Austarieren der Grundlagen unserer freiheitlich demokratischen Gesellschaft. Wie auch in der Sachverständigenanhörung zum ethnisch-kulturellen Volksbegriff (link) deutlich wurde, dass dieser per se keinesfalls extremistisch sei, wurde auch hier bei den Beurteilungsmaßstäben von Eingriffsmöglichkeiten klar, dass es immer wieder einer grundlegenden und überprüfenden Debatte bedarf. Begriffe wie Wissenschaftsfreiheit oder Meinungsfreiheit sollten klar ausgedeutet werden und nicht als Rechtfertigung für Wahrnehmung rechtfertigungsbedürftiger staatlicher Aufgaben herangezogen werden.
Die Debatte ist als erster Tagesordnungspunkt im Online-Archiv des Abgeordnetenhauses nachzusehen:
Über die Ausschusssitzung berichtete die Berliner Morgenpost online am 17.03.2025: AfD-Verbotsantrag: Dürfen zivile Organisationen dabei helfen?, (link).
Zum AfD-Verbotsantrag habe ich mich auch bereits im Plenum geäußert (link)