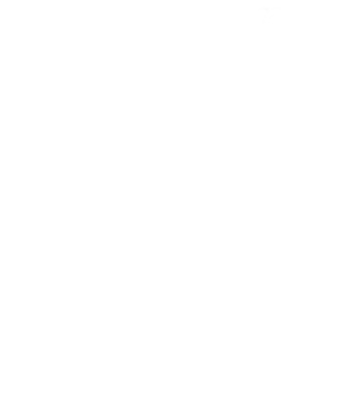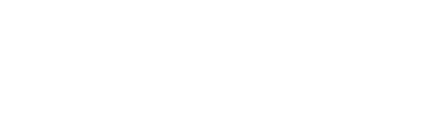Für den Senat vertrat Staatssekretär Hochgrebe folgende Ansichten: Seit der Gründung der Beratungsstelle Berlin, die mit Prävention islamismusgefährdeten Jugendlichen und Heranwachsenden sowie deren Umfeld hilft, hat sich diese etabliert. Der Staatssekretär betonte jedoch, das Bedrohungspotenzial des Islamismus sei seit dem Angriff der Terrororganisation Hamas am 7. Oktober 2023 enorm gestiegen. Darauf müsse man mit einer noch besseren Präventionsarbeit antworten. Zu diesem Zweck seien im laufenden Doppelhaushalt 2024/2025 1,9 Millionen Euro für das Landesprogramm Radikalisierungsprävention vorgesehen.
Die Sachverständigen Frau Oehlmann und Herr Dr. Nordbruch machten vor allem auf das Engagement der zivilgesellschaftlichen Organisationen aufmerksam. Auch gebe es Parallelen zwischen Rechtsextremismus und Islamismus, so begünstige ersterer sogar letzteren, denn ausgegrenzte und abgewertete Jugendliche mit Migrationshintergrund seien oftmals anfälliger für radikale Ansichten. Alle müssen sich vom Rechtsstaat abgeholt fühlen.
Herr Mücke machte deutlich, dass sich Radikalisierung vermehrt im Internet abspielt. Damit einher gehe eine deutliche Verjüngung der Szene. Wie auch Frau Oehlmann und Herr Dr. Nordbruch bemerkte Herr Mücke, die Lebensumstände hätten einen großen Einfluss auf das Radikalisierungspotenzial.
Der Sachverständige Ahmad Mansour erläuterte, wir befänden uns seit dem siebten Oktober 2023 in einer dritten Radikalisierungswelle. Er machte auch auf die Hintergründe der Gefährdeten aufmerksam: Diese sind oftmals in der dritten Generation in Deutschland, können sich aber trotzdem nicht mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung identifizieren. Politische Bildung sei wenig präsent, auch werden Nachrichten oftmals vor allem aus dem Internet bezogen. Dort sind die Algorithmen so programmiert, dass es stark polarisierende Inhalte wesentlich leichter haben als gemäßigte Inhalte. So kann eine Radikalisierung nahezu unbemerkt vom Umfeld stattfinden. Auch führt der übermäßige Konsum sozialer Medien zu einem drastischen Empathieabbau. Herr Mansour bemerkte, dass Geflüchtete gut unterstützt und integriert werden müssen, da sie sonst anfälliger für extreme Ansichten seien.
Wir müssen wegkommen von dem klassischen, oftmals weit verbreiteten Motto ,,Wir gegen die“ - Nichtmuslime gegen Muslime. Unsere Devise muss vielmehr lauten: wir Mehrheitsgesellschaft, die sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennt, gegen den politischen Islam.
Zweifelsohne steht die Radikalisierungsprävention in Berlin vor großen Herausforderungen, jedoch ergeben sich auch große Chancen, aus der Zusammenarbeit zwischen Praxis und Wissenschaft, mit Sicherheitsbehörden sowie mit flankierenden psychosozialen Angeboten. Man könnte auch eventuell über Kooperationen mit islamischen Gemeinden oder mit Jugendgerichten nachdenken. Auch im Internet muss ein viel größeres Angebot der Präventionsarbeit stattfinden, etwa mit Aufklärungsvideos, einer WhatsApp- oder Signal-Hotline oder Ratgebern zum Umgang mit extremistischen Ansichten im Umfeld. Dabei werden zivilgesellschaftliche Organisationen weiterhin eine große Rolle spielen. Der Staat darf seine Verpflichtung, für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu sorgen, aber nicht außer Acht lassen. Dafür müssen Sicherheitsbehörden mit ausreichend Mitteln und Befugnissen ausgestattet werden. Auch die zivilgesellschaftlichen Organisationen sollten genügend finanziert werden. Die unbefristete finanzielle Unterstützung -wie in der Ausschusssitzung gefordert- steht dabei jedoch im Gegensatz zu der unabhängigen, freien und selbständigen Arbeit der NGOs – Nichtregierungsorganisationen.
Oft wird das Wir-Gefühl angepriesen, das man stärken müsse. Doch mangelt es diesbezüglich an einem klaren, parteiübergreifenden Verständnis. Ahmad Mansour war für einen Umgang mit dem muslimischen Teil der Bevölkerung auf Augenhöhe. Dies schließe auch ein, etwas von den betroffenen Menschen zu verlangen und zu fordern.
Für mich ist klar, dass ein gemeinsames Wir-Gefühl mindestens auf dem Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung beruhen muss. Man darf Musliminnen und Muslime weder ausgrenzen, noch ihnen von vornherein eine ungewünschte Opferrolle zusprechen. Beides sind Formen von Diskriminierung. Eine Frage, die ich auch in der Ausschusssitzung stellte, möchte ich hier nochmals wiederholen: Müssen wir fordernder werden? Ja, das müssen wir. Vor allem müssen wir das Bekenntnis zu unseren Werten, insbesondere zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung und zum Existenzrecht Israels zur Bedingung für eine langfristige Aufenthaltserlaubnis und erst recht für die Einbürgerung machen.
Abschließend ist festzuhalten, dass trotz bestehender Probleme die Radikalisierungsprävention in Berlin den richtigen Ansatz verfolgt. Um den wachsenden Herausforderungen der Zukunft besser zu begegnen, müssen Kooperationen weiter ausgebaut und Strukturen verändert werden. Vor allem aber muss unser Wertekanon viel fester in der Bevölkerung verankert werden; dann sinkt auch das Risiko für Extremismus und Gewalt aller Art.
Der Mitschnitt der Ausschusssitzung ist auf YouTube zu finden.